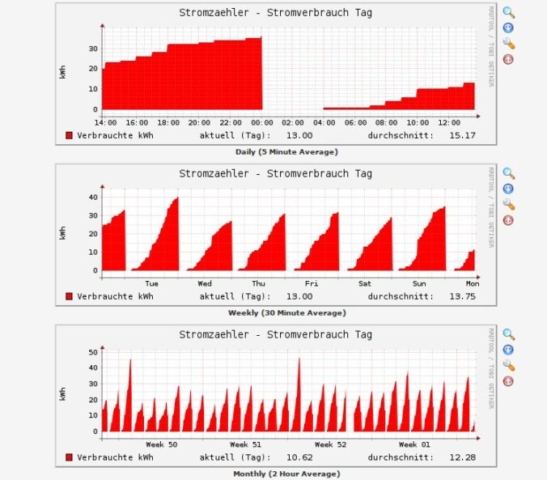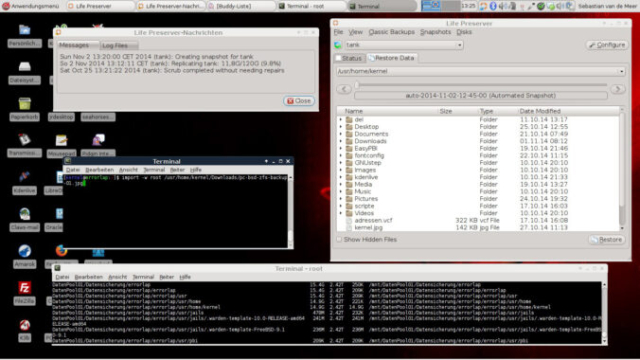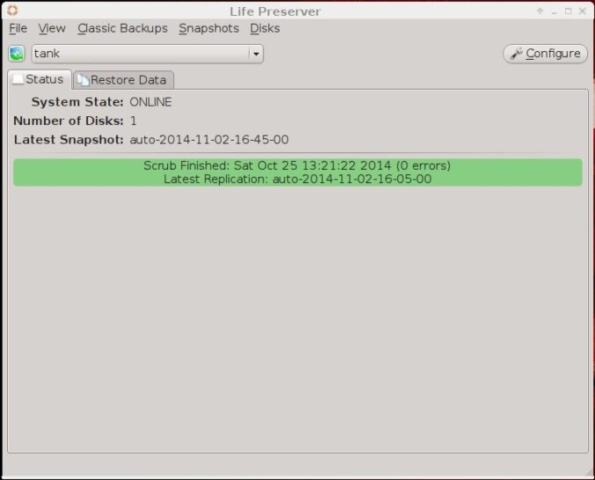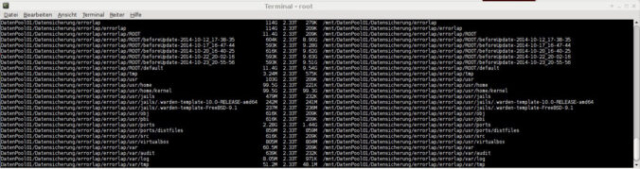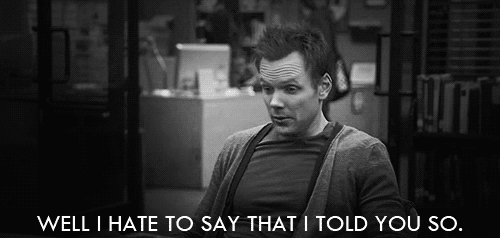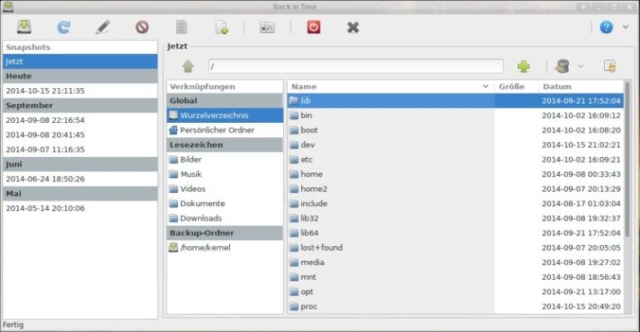Nachdem ich nun für die S2S-Verbindungen TLS erzwinge, sind ein paar Openfire User zu mir gekommen und beklagen sich darüber, dass ihre User im Client ein: „404 remote server not found“ bekommen.
Verbindungen/Nachrichten in die eine Richtung gehen durch und wenn die Unterhaltung einmal gestartet ist, „klappt“ es dann auch für eine gewisse Zeit. Ich muss zugeben, ein etwas spannender Effekt, welchen einen nicht direkt auf die Lösung des Problem bringt. Das Problem liegt nicht an meinem Jabber Server und nicht an meinen DNS Einstellungen. Es hängt tatsächlich am Openfire auf der Gegenseite. Java 6 fehlt im Keystore das Intermediate Zertifikat von StartSSL. Mein Server sendet es zwar mit, denn noch bekommt es Java 6 und einige Versionen 7 wohl nicht hin, die Kette korrekt zu bauen. Im Openfire warn.log finden sich dann Meldungen wie:
warn.log.1:2014.11.18 08:00:48 org.jivesoftware.openfire.server.ServerDialback - Error verifying key of remote server: jabber.kernel-error.de warn.log.1:2014.11.18 08:00:48 org.jivesoftware.openfire.server.ServerDialback - ServerDialback: OS - Ignoring unexpected answer in validation from: kernel-error.de id: 1234567890 for domain: JABBERDOMAIN answer:<stream:features xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams"><starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"><required/></starttls></stream:features>
Erschlagen lässt sich dieses Problem, indem der Admin des Openfire-Systems einfach das Intermediate Zertifikat der CA in seinen Keystore packt. Wie? so…
Zuerst in den default Ordner des Openfire auf einem Debian System wandern und dann den Openfire zur Sicherheit beenden:
$ cd /etc/openfire/security/ $ /etc/init.d/openfire stop
Jetzt das Zertifikat von der Webseite der CA herunterladen und es importieren:
$ wget "http://www.startssl.com/certs/sub.class2.server.ca.crt" $ keytool -import -keystore truststore -alias startcom.ca.sub2 -file sub.class2.server.ca.crt Enter keystore password: Certificate was added to keystore
Default Kennwort ist: changeit
Wenn man schon dabei ist, kann man (sofern gewünscht) auch direkt die Zertifikate von CAcert.org importieren. Viele Systeme nutzen diese:
$ wget "http://www.cacert.org/certs/root.crt" $ keytool -import -keystore truststore -alias CAcert.root.ca -file root.crt Enter keystore password: Certificate already exists in keystore under alias <CAcert.root.ca> Do you still want to add it? [no]: no Certificate was not added to keystore $ wget "http://www.cacert.org/certs/class3.crt" $ keytool -import -keystore truststore -alias CAcert.Class3.sub.ca -file class3.crt Enter keystore password: Certificate was added to keystore
Ist eines der Zertifikate bereits vorhanden, macht es natürlich keinen Sinn dieses zu überschreiben, sofern es kein Problem mit diesem gibt.
Als letzten Schritt einfach Openfire wieder starten.
$ /etc/init.d/openfire start
Ab jetzt sollte es dann zu keinen hässlichen Logmeldungen mehr führen und alle können wieder schreiben 🙂
So long….
* U-P-D-A-T-E *
Da die Frage inzwischen schon vier mal bei mir angekommen ist… Wie testet man denn ob das Intermidiate Zertifikate überhaupt korrekt mit übergeben wird? Ganz einfach mit openssl 🙂
Spannend ist hier die Zeile: Verify return code: 0 (ok)
Steht hier etwas anderes, gibt es ein Problem.
$ openssl s_client -showcerts -connect jabber.kernel-error.de:5222 -starttls xmpp
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = IL, O = StartCom Ltd., OU = Secure Digital Certificate Signing, CN = StartCom Certification Authority
verify return:1
depth=1 C = IL, O = StartCom Ltd., OU = Secure Digital Certificate Signing, CN = StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA
verify return:1
depth=0 description = pViXGk1aRdP23kII, C = DE, ST = Nordrhein-Westfalen, L = Hattingen, O = Sebastian Van De Meer, CN = jabber.kernel-error.de, emailAddress = postmaster@kernel-error.de
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:/description=pViXGk1aRdP23kII/C=DE/ST=Nordrhein-Westfalen/L=Hattingen/O=Sebastian Van De Meer/CN=jabber.kernel-error.de/emailAddress=postmaster@kernel-error.de
i:/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=Secure Digital Certificate Signing/CN=StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIG4zCCBcugAwIBAgIDAjIFMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJJ
TDEWMBQGA1UEChMNU3RhcnRDb20gTHRkLjErMCkGA1UECxMiU2VjdXJlIERpZ2l0
YWwgQ2VydGlmaWNhdGUgU2lnbmluZzE4MDYGA1UEAxMvU3RhcnRDb20gQ2xhc3Mg
MiBQcmltYXJ5IEludGVybWVkaWF0ZSBTZXJ2ZXIgQ0EwHhcNMTQwNTE4MTU0NTU2
WhcNMTYwNTE4MTgwOTMwWjCBxjEZMBcGA1UEDRMQcFZpWEdrMWFSZFAyM2tJSTEL
MAkGA1UEBhMCREUxHDAaBgNVBAgTE05vcmRyaGVpbi1XZXN0ZmFsZW4xEjAQBgNV
BAcTCUhhdHRpbmdlbjEeMBwGA1UEChMVU2ViYXN0aWFuIFZhbiBEZSBNZWVyMR8w
HQYDVQQDExZqYWJiZXIua2VybmVsLWVycm9yLmRlMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhpw
b3N0bWFzdGVyQGtlcm5lbC1lcnJvci5kZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAKJmXUJxwqipigjZf5cdLCMLcyThMO0Jtl7liZbh5Mxklho/NONN
PFdOT4thBG63SDol7XJm3ke1MJLZJeaaYXXXUo5aEQ8U1DGImSerfs8cexLFAczo
qc8c6Jm5x2wXhDIxpU7zaL9duX1gaJ8mbNiX+xoNUdx9QIENlXz/xdtVu0l95McK
Esrk3OZ11wyF1GSnFJtAQNC9Bn7fPV4kArZdh/OV+0tTUpM+EMG8PR2iQg6uVvhN
TNwzRKrxTVClmBRLyeT10Nhjt3rkB+bhGCWbXVtwitS3mlMEL7QoNPj7iRbIOUfF
TheJJ3x3PjxfmAubpfo/ndsGjV2c/jw2OmMCAwEAAaOCAxAwggMMMAkGA1UdEwQC
MAAwCwYDVR0PBAQDAgOoMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDATAd
BgNVHQ4EFgQU/3ZeNF1M/zhTpWBrad0YI7q3BGAwHwYDVR0jBBgwFoAUEdsjRf1U
zGpxb4SKA9e+9wEvJoYwTAYDVR0RBEUwQ4IWamFiYmVyLmtlcm5lbC1lcnJvci5k
ZYIPa2VybmVsLWVycm9yLmRlghgqLmphYmJlci5rZXJuZWwtZXJyb3IuZGUwggFW
BgNVHSAEggFNMIIBSTAIBgZngQwBAgIwggE7BgsrBgEEAYG1NwECAzCCASowLgYI
KwYBBQUHAgEWImh0dHA6Ly93d3cuc3RhcnRzc2wuY29tL3BvbGljeS5wZGYwgfcG
CCsGAQUFBwICMIHqMCcWIFN0YXJ0Q29tIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5
MAMCAQEagb5UaGlzIGNlcnRpZmljYXRlIHdhcyBpc3N1ZWQgYWNjb3JkaW5nIHRv
IHRoZSBDbGFzcyAyIFZhbGlkYXRpb24gcmVxdWlyZW1lbnRzIG9mIHRoZSBTdGFy
dENvbSBDQSBwb2xpY3ksIHJlbGlhbmNlIG9ubHkgZm9yIHRoZSBpbnRlbmRlZCBw
dXJwb3NlIGluIGNvbXBsaWFuY2Ugb2YgdGhlIHJlbHlpbmcgcGFydHkgb2JsaWdh
dGlvbnMuMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuc3RhcnRzc2wuY29t
L2NydDItY3JsLmNybDCBjgYIKwYBBQUHAQEEgYEwfzA5BggrBgEFBQcwAYYtaHR0
cDovL29jc3Auc3RhcnRzc2wuY29tL3N1Yi9jbGFzczIvc2VydmVyL2NhMEIGCCsG
AQUFBzAChjZodHRwOi8vYWlhLnN0YXJ0c3NsLmNvbS9jZXJ0cy9zdWIuY2xhc3My
LnNlcnZlci5jYS5jcnQwIwYDVR0SBBwwGoYYaHR0cDovL3d3dy5zdGFydHNzbC5j
b20vMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBcMcSJxbr52s1gzaH7zjh0FfveuiTvPIZY
enV1UxoPZLeFMAIUsZf2h/hGTXDNhH48bcF8eRcbMnPhS8xQPEXSNd7yFtPnpE6c
3jdjE6+Fm3Rd6MZ8BIruB98T8cc74LK3NoWxdnJNLs3+D2W2lMUjpCUgggHSNoOt
d73lXFYSxbu7+lOIE/w0oQeYKD6/aGGgZFaUdM2B1OHEz2z9skhQgFJkM6aAFK03
sH4KaYnwdnyNpuS8XpPhmrQ6KMZBQMi43TcH3mQtgTUXjZOC7i8ZSLzAtg0mdqSy
CJqfAKS6X/7ARyMHNNlZWDWXRuScs2k7x58afIx60MTp50SFSB4F
-----END CERTIFICATE-----
1 s:/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=Secure Digital Certificate Signing/CN=StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA
i:/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=Secure Digital Certificate Signing/CN=StartCom Certification Authority
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGNDCCBBygAwIBAgIBGjANBgkqhkiG9w0BAQUFADB9MQswCQYDVQQGEwJJTDEW
MBQGA1UEChMNU3RhcnRDb20gTHRkLjErMCkGA1UECxMiU2VjdXJlIERpZ2l0YWwg
Q2VydGlmaWNhdGUgU2lnbmluZzEpMCcGA1UEAxMgU3RhcnRDb20gQ2VydGlmaWNh
dGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMDcxMDI0MjA1NzA5WhcNMTcxMDI0MjA1NzA5WjCB
jDELMAkGA1UEBhMCSUwxFjAUBgNVBAoTDVN0YXJ0Q29tIEx0ZC4xKzApBgNVBAsT
IlNlY3VyZSBEaWdpdGFsIENlcnRpZmljYXRlIFNpZ25pbmcxODA2BgNVBAMTL1N0
YXJ0Q29tIENsYXNzIDIgUHJpbWFyeSBJbnRlcm1lZGlhdGUgU2VydmVyIENBMIIB
IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4k85L6GMmoWtCA4IPlfyiAEh
G5SpbOK426oZGEY6UqH1D/RujOqWjJaHeRNAUS8i8gyLhw9l33F0NENVsTUJm9m8
H/rrQtCXQHK3Q5Y9upadXVACHJuRjZzArNe7LxfXyz6CnXPrB0KSss1ks3RVG7RL
hiEs93iHMuAW5Nq9TJXqpAp+tgoNLorPVavD5d1Bik7mb2VsskDPF125w2oLJxGE
d2H2wnztwI14FBiZgZl1Y7foU9O6YekO+qIw80aiuckfbIBaQKwn7UhHM7BUxkYa
8zVhwQIpkFR+ZE3EMFICgtffziFuGJHXuKuMJxe18KMBL47SLoc6PbQpZ4rEAwID
AQABo4IBrTCCAakwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYD
VR0OBBYEFBHbI0X9VMxqcW+EigPXvvcBLyaGMB8GA1UdIwQYMBaAFE4L7xqkQFul
F2mHMMo0aEPQQa7yMGYGCCsGAQUFBwEBBFowWDAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDov
L29jc3Auc3RhcnRzc2wuY29tL2NhMC0GCCsGAQUFBzAChiFodHRwOi8vd3d3LnN0
YXJ0c3NsLmNvbS9zZnNjYS5jcnQwWwYDVR0fBFQwUjAnoCWgI4YhaHR0cDovL3d3
dy5zdGFydHNzbC5jb20vc2ZzY2EuY3JsMCegJaAjhiFodHRwOi8vY3JsLnN0YXJ0
c3NsLmNvbS9zZnNjYS5jcmwwgYAGA1UdIAR5MHcwdQYLKwYBBAGBtTcBAgEwZjAu
BggrBgEFBQcCARYiaHR0cDovL3d3dy5zdGFydHNzbC5jb20vcG9saWN5LnBkZjA0
BggrBgEFBQcCARYoaHR0cDovL3d3dy5zdGFydHNzbC5jb20vaW50ZXJtZWRpYXRl
LnBkZjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAgEAnQfh7pB2MWcWRXCMy4SLS1doRKWJwfJ+
yyiL9edwd9W29AshYKWhdHMkIoDW2LqNomJdCTVCKfs5Y0ULpLA4Gmj0lRPM4EOU
7Os5GuxXKdmZbfWEzY5zrsncavqenRZkkwjHHMKJVJ53gJD2uSl26xNnSFn4Ljox
uMnTiOVfTtIZPUOO15L/zzi24VuKUx3OrLR2L9j3QGPV7mnzRX2gYsFhw3XtsntN
rCEnME5ZRmqTF8rIOS0Bc2Vb6UGbERecyMhK76F2YC2uk/8M1TMTn08Tzt2G8fz4
NVQVqFvnhX76Nwn/i7gxSZ4Nbt600hItuO3Iw/G2QqBMl3nf/sOjn6H0bSyEd6Si
BeEX/zHdmvO4esNSwhERt1Axin/M51qJzPeGmmGSTy+UtpjHeOBiS0N9PN7WmrQQ
oUCcSyrcuNDUnv3xhHgbDlePaVRCaHvqoO91DweijHOZq1X1BwnSrzgDapADDC+P
4uhDwjHpb62H5Y29TiyJS1HmnExUdsASgVOb7KD8LJzaGJVuHjgmQid4YAjff20y
6NjAbx/rJnWfk/x7G/41kNxTowemP4NVCitOYoIlzmYwXSzg+RkbdbmdmFamgyd6
0Y+NWZP8P3PXLrQsldiL98l+x/ydrHIEH9LMF/TtNGCbnkqXBP7dcg5XVFEGcE3v
qhykguAzx/Q=
-----END CERTIFICATE-----
---
Server certificate
subject=/description=pViXGk1aRdP23kII/C=DE/ST=Nordrhein-Westfalen/L=Hattingen/O=Sebastian Van De Meer/CN=jabber.kernel-error.de/emailAddress=postmaster@kernel-error.de
issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=Secure Digital Certificate Signing/CN=StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 4537 bytes and written 612 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Cipher : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Session-ID:
Session-ID-ctx:
Master-Key: 98D942E7D6BD132AE7E19F13AFBE5C0C7A2F4CA651B9679B98E200A841572ABE78BB43B5572C1929B2423EC61008BBDD
Key-Arg : None
Krb5 Principal: None
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
Start Time: 1416399042
Timeout : 300 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
---
read:errno=0